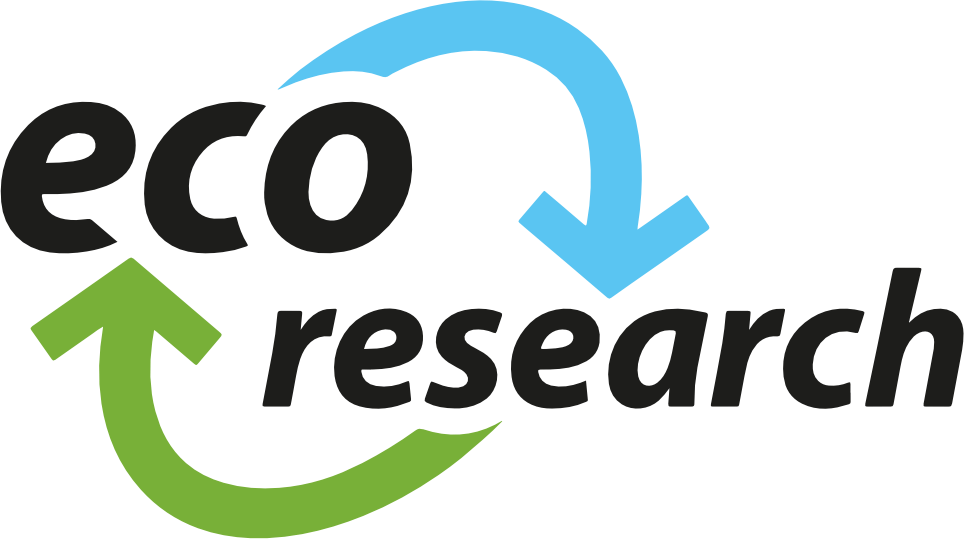Entfernung von Mikroplastik aus kommunalem Abwasser: Eine Studie zur Effizienz von Kläranlagen
Die weltweite Kunststoffproduktion ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen – ebenso wie die damit verbundenen Umweltprobleme. Ein zunehmend dringlicher Aspekt ist die Verbreitung von Mikro- und Nanoplastik: Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 5 mm, die durch die Zersetzung von Kunststoffprodukten oder -abfällen entstehen. Aufgrund ihrer Persistenz stellen sie ein Risiko für Umwelt und menschliche Gesundheit dar, da sie nicht nur Schadstoffe freisetzen, sondern auch Krankheitserreger transportieren können. In städtischen Gebieten gelangen Mikroplastikpartikel hauptsächlich durch Haushaltsabwässer und Oberflächenabfluss in das Abwassersystem. Da diese Wässer in Kläranlagen behandelt werden, ist es entscheidend zu überprüfen, ob die derzeitigen Reinigungsstufen ausreichen, um Mikroplastik effektiv zu entfernen.
Dies war das Ziel einer neuen Studie, die in Zusammenarbeit zwischen der Universität Trient, der Universität Florenz, Eco Research und Eco Center durchgeführt wurde. Die Untersuchungen fanden in einer lokalen Kläranlage statt, wobei Menge und Art der Mikroplastikpartikel (10–5000 μm) in den verschiedenen Reinigungsstufen analysiert wurden. Zum Einsatz kamen drei sich ergänzende Analysemethoden: FTIR-Spektroskopie, LDIR-Spektroskopie und TD-GC/MS.
Die Ergebnisse zeigen, dass Kläranlagen mehr als 96 % der Mikroplastikpartikel aus dem Abwasser entfernen können. Diese sammeln sich jedoch größtenteils im Klärschlamm an, der häufig als Dünger in der Landwirtschaft wiederverwendet wird. Dadurch entsteht ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Wiedereintragung von Mikroplastik in die Umwelt. Daher sind gezielte Strategien für ein nachhaltiges Klärschlammmanagement notwendig, z. B. durch zusätzliche Behandlungsstufen wie Verbrennung oder Pyrolyse, um die Rückführung von Mikroplastik in die Umwelt zu verhindern.
A B S T R A C T
This study investigated microplastics (MPs) sized 10–5000 µm across stages of a conventional municipal wastewater treatment plant using multiple analytical techniques. Samples were collected via pumping and filtration, treated with the Fenton reaction for wet peroxidation, and separated by density separation. Analysis employed Focal Plane Array Micro-Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FPA micro-FTIR), a widely used technique in MPs analysis, alongside the less common Laser Direct Infrared Spectroscopy (LDIR), providing complementary data on particle composition, shape, size, and colour. To enhance insights, spectroscopic methods were supplemented with Thermal Desorption Gas Chromatography-Mass Spectrometry (TD-GC/MS), calibrated for specific polymers, to quantify MPs by mass and assess removal efficiency. Wastewater treatment effectively reduced MPs. In influent samples, concentrations reached 72 MPs/L (FTIR), 2117 MPs/L (LDIR), and 177 µg/L (TD-GC/MS). Primary treatments removed 41 %–55 %, while the wastewater treatment plant effluent contained 1 MPs/L (FTIR), 93 MPs/L (LDIR), and 2 µg/L (TD-GC/MS), reflecting 96 %–99 % removal efficiency. Activated sludge showed concentrations of 123 MPs/L (FTIR), 10,800 MPs/L (LDIR), and 0.3 mg/g dry weight (TD-GC/MS), underscoring its role in MPs capture. However, sludge dewatering released significant MPs into centrifuge rejected water: 484 MPs/L (FTIR), 23,000 MPs/L (LDIR), and 1100 µg/L (TD-GC/MS). These results highlight the effectiveness of conventional treatments in MPs removal and the critical role of sludge in capturing these contaminants. However, sludge dewatering poses a risk of reintroducing MPs into the environment. Effective sludge management should prioritize nutrient recovery and biomass valorisation to mitigate these risks and minimise harmful environmental impacts.